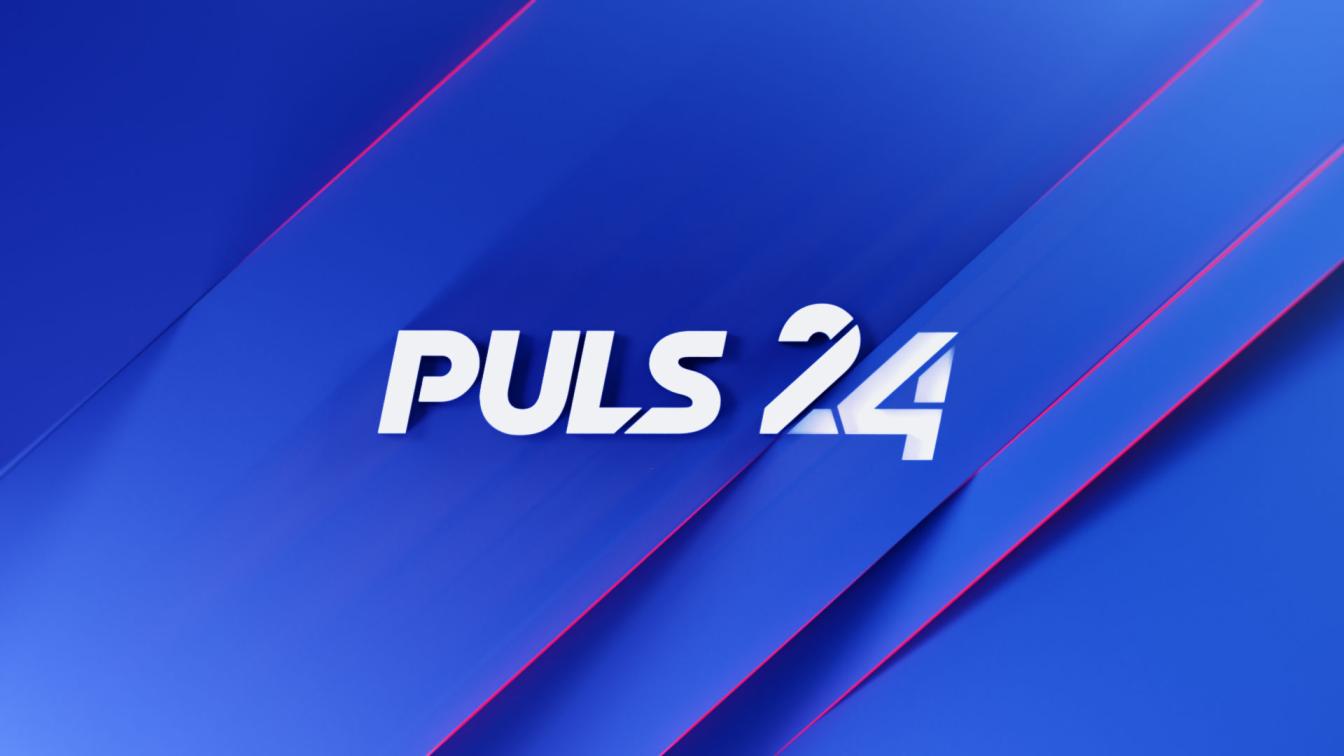Ungelöste Probleme in der Kinder- und Jugendpsychiatrie
"Wir produzieren durch diesen Mangel chronisch kranke Erwachsene", ergänzte Helmut Krönke, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie mit eigener Praxis in Wien und Bundesfachgruppen-Obmann in der Ärztekammer: "Und das zahlen wir in der Zukunft, denn ein solcher Erwachsener wird in unser Sozialsystem nicht mehr viel einzahlen." Schon vor Ausbruch der Pandemie fehlten in Österreich 50 Prozent der benötigen Krankenhausbetten, im Februar 2021 wiesen dann mehr als die Hälfte, nämlich 55 Prozent der Jugendlichen, depressive Symptome auf, 47 Prozent Angstsymptome, 22,8 Prozent litten an Schlaflosigkeit und bei 59,5 Prozent offenbarte sich ein gestörtes Essverhalten. Während bereits die Pandemie schon wie ein Brennglas gewirkt habe, kämen durch den Ukraine-Krieg oder durch drohende Armut weitere Belastungen dazu.
In den Kinder- und Jugendpsychiatrien nimmt man indessen einen sogenannten "Drehtürfeffekt" wahr, den Sevecke durch die kurzen Verweildauern erklärt, die dann wegen mangelnden Behandlungserfolgs wieder zu hohen Wiederaufnahmeraten führen. "Psychische Erkrankungen nehmen nicht nur zu, sie werden auch immer komplexer, wie die Bedrohlichkeit der Krisen zunimmt", ergänzte Judith Noske, Leiterin der Kinder- u. Jugendpsychiatrie am Standort Hinterbrühl des Landesklinikum Baden-Mödling. Laut Noske stehe man vor dem seit Corona bekannten Problem der Triage, also vor der Frage, wie die begrenzten Ressourcen an Behandlungsmöglichkeiten auf die jungen Patienten verteilt werden.
"Therapeutische Behandlungskonzepte können nur noch selten angeboten werden", so Noske und erklärt die Folgen an einer fiktiven Patientin: Julia, 15 Jahre alt, Gymnasiastin mit seit drei Monaten bestehenden Suizidgedanken, die sich aufgrund von Schulängsten in sozialer Isolation gebildet haben und die unter Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper leidet. "Eine kurze stationäre Aufnahme von zwei Tagen bringt Entlastung", erläutert die Expertin den Anfang des Leidenswegs.
Dann gibt es jedoch die Folgen des Bettenmangels, nämlich sechs bis neun Monate Wartezeit auf einen therapeutisch-diagnostischen Aufenthalt, überbrückend werden Kontrollen durch einen Facharzt empfohlen - drei bis vier Monate Wartezeit auf einen Ersttermin sind hier die Realität. Die ebenfalls empfohlene Psychotherapie soll angesichts der finanziellen Situation ihrer Eltern über ein Beratungszentrum organisiert werden, die Wartezeit auf einen Kassenplatz beträgt sechs bis 18 Monate.
Inzwischen kommt es bei der Patientin zu auffälligem Essverhalten, also wird in einem darauf spezialisierten Zentrum nach einem früherem Therapieplatz gesucht, aber aufgrund der Personalsituation können auch hier keine neuen Patientinnen aufgenommen werden. Die Eltern sind völlig verzweifelt, und Julia ist still. Vereinbart wird, dass sie sich im Falle von akuten Krisen umgehend melden soll, es werden überbrückend stabilisierende Gespräche an der Abteilung angeboten. Die Patientin ist bemüht, trotzdem wird zweimal ein Krisenaufenthalt nötig, erst nach fünf Monaten kann Julia stationär aufgenommen werden.
Zu diesem Zeitpunkt besteht bereits ein somatisch bedenkliches Untergewicht, Julia geht nicht mehr aus dem Haus, geht nicht mehr in die Schule und verletzt sich jetzt auch selbst, hat massive soziale Ängste. Die familiäre Situation ist hoch angespannt und die jüngeren Geschwister zeigen bereits erste Auffälligkeiten. Es wird an einen therapeutischen Fremdunterbringungsplatz in einer Wohngemeinschaft gedacht, Wartezeit: voraussichtlich über ein Jahr. "Das mag vielleicht dramatisch klingen, aber Fälle wie Julia sind keine Seltenheit", so Noske. Tragisch sei das, weil eine frühe Behandlung in sehr vielen Fällen all diese Folgen verhindern könne.
Was die meisten Mitarbeiter betrifft, so würden diese eine hohe Identifikation mit ihrer Arbeit zeigen, "sie haben alle viel geleistet, doch sind sie sehr erschöpft und können nicht mehr", sagte Noske über ihre Kollegenschaft - und es sei nicht zu erwarten, dass sich hier viel ändern werde. Die Situation sei in jedem Bundesland schlecht, sagte Facharzt Krönke. Wien habe zwar mehr Wahlärzte zur Verfügung, das Problem sei aber die stationäre Versorgung, und "da ist die Frage, wen melde ich da überhaupt an" - also die Triage. Das Wiener Krankenhaus Nord habe etwa weiterhin keinen stationären Betrieb, die Situation um den Rosenhügel sei ein tragisches Negativbeispiel.
Insgesamt ergebe sich österreichweit eine Problematik, die sich je nach Bundesland einmal schärfer im niedergelassenen und einmal schärfer im stationären Bereich offenbare, letztgenannter wurde laut Sevecke über Jahre hin vernachlässigt. Im Burgenland gibt es im niedergelassenen Bereich nicht einmal eine Stelle mit Kassenvertrag. Das Resultat sind dann junge Menschen mit mittelschweren und leichtgradigen Erkrankungen, deren Beschwerden sich aufgrund der langen Wartezeiten verdichten, während sich die schwerkranken Patienten zurück in den niedergelassenen Bereich stauen.
Vor diesem Hintergrund fordert die ÖGKJP einmal doppelt so viel Personal in allen Berufsgruppen in der Kinderpsychiatrie sowie eine flächendeckende Psychotherapie für Kinder und Jugendliche auf Krankenschein. Ebenso sei die Einrichtung eines oder einer Koordinator*in auf höchster Ebene nötig, etwa als Staatssekretariat, um das Thema "Mental Health" im Kindes- und Jugendalter ministeriumsübergreifend zu koordinieren, wie es in anderen Staaten, etwa in England, bereits der Fall sei. Das von der Regierung im Februar präsentierte Paket für einen besseren Zugang zu Psychotherapie für junge Menschen mit 13 Millionen Euro würde jedenfalls nicht reichen: "Das sind sechs Euro pro Person - zu wenig muss man sagen", bilanzierte Krönke.
Zusammenfassung
- Die Situation sei in jedem Bundesland schlecht, sagte Facharzt Krönke.
- Im Burgenland gibt es im niedergelassenen Bereich nicht einmal eine Stelle mit Kassenvertrag.